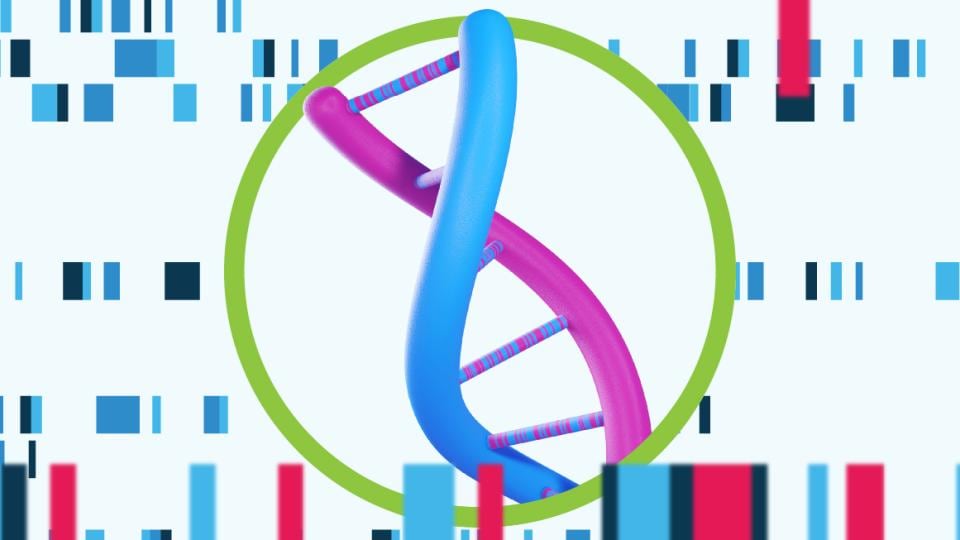Leben mit Blutarmut

Maya Hügle muss regelmäßig zur Blutwäsche in die Uniklinik.
Seit ihrer Jugend leidet Maya Hügle an Blutarmut. Die Krankheit bestimmt bis heute ihren Alltag – mit häufigen Injektionen und wiederkehrenden Erschöpfungszuständen. Forschende Pharmaunternehmen wie Bayer suchen deshalb nach Wegen, die Behandlung zu verbessern.
Maya Hügle hatte auch mal ein anderes Leben. Eins mit Träumen, Hoffnungen, Zukunftsplänen. Eins, in dem sie Forscherin werden und für ihren lungenkranken Vater ein Medikament erfinden wollte. Eins mit einer ersten großen Liebe, heimlichen Partys und einem Ausbildungsplatz als Arzthelferin in einer Dürener Praxis, ganz in der Nähe ihres Heimatortes. „Ich hatte alles, was sich eine junge Frau damals nur wünschen konnte“, sagt sie. „Ich war bis zum Bersten angefüllt mit Lebenslust und Energie.“
Maya Hügle erzählt gern ihre Geschichte. Sie will aufklären. Denn die Patientin leidet seit 40 Jahren an Blutarmut (Anämie), einer schwerwiegenden Begleiterscheinung ihrer Niereninsuffizienz. Die Niere der 59-Jährigen produziert nicht mehr genug Erythropoetin (EPO), das als wichtiger Wachstumsfaktor zur Bildung roter Blutkörperchen dient. Beim gesunden Menschen reguliert das körpereigene Hormon die Bildung der roten Blutkörperchen im Knochenmark abhängig vom Sauerstoffgehalt des Blutes. In diesen roten Blutkörperchen ist Hämoglobin, auch Hb genannt. Dieses eisenhaltige Protein bindet den Sauerstoff, der dann über den Blutkreislauf zu den Organen gelangt. Ist ausreichend Sauerstoff vorhanden, so bedarf es nur wenig EPO. Sinkt der Sauerstoffgehalt, so wird im nierengesunden Menschen mehr EPO gebildet.

Bei Maya Hügle funktioniert dieser Kreislauf nicht. Schon in ihrer Ausbildungszeit litt sie oft an starken Kopfschmerzen, war schnell müde und erschöpft. „Das lag daran, dass mein Herz viel stärker pumpen musste, um genügend Sauerstoff zu den Organen zu transportieren – es waren ja nicht genug rote Blutkörperchen da“, erklärt sie. Doch die behandelnden Ärzte verkannten ihre Krankheit: „Sie verschrieben mir Kopfschmerztabletten und diagnostizierten psychische Ursachen.“ Die damals 19-Jährige war verunsichert und überzeugt, sich mit ihrer Zusatzausbildung zur Laborantin zu sehr unter Druck zu setzen. Bis zu diesem schicksalhaften Sommerurlaub mit ihrer Mutter im Frankenwald: Von einem Moment auf den anderen brach sie zusammen.
Seit der Diagnose beherrscht die Krankheit Maya Hügles Alltag. Denn Anämiekranke bekommen immer wieder Injektionen mit gentechnisch hergestelltem EPO, ein Verfahren, das seit den 80er-Jahren angewandt wird: Über Wochen hinweg lassen die Spritzen ihren Hb-Wert ansteigen. Auch wenn der Wert hoch genug ist, muss die Patientin häufig zur Kontrolle und regelmäßig Spritzen bekommen, um diesen Wert zu halten. Aktuell ist die Gabe von gentechnisch hergestelltem EPO die einzige Möglichkeit, den EPO-Mangel bei Patienten mit Nierenerkrankung zu behandeln.

Universitätskliniken, medizinische Institute und forschende Pharma-Unternehmen wie Bayer wollen den Betroffenen helfen. Denn die derzeitige Behandlungsmethode birgt auch gesundheitliche Risiken: „Die EPO-Injektionen erhöhen die Produktion roter Blutkörperchen deutlich, doch eine vollständige Korrektur der Blutarmut hin zu Werten von Gesunden war in großen Studien, in denen EPO eingesetzt wurde, mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko verbunden“, erklärt Thilo Krüger, Experte für Nierenerkrankungen bei Bayer. „Aufgrund des erwähnten erhöhten kardiovaskulären Risikos beschränken Leitlinien und Hersteller von EPO aktuell die komplette Korrektur der Blutarmut.“

Die Mediziner forschen deshalb an einer alternativen Therapiemöglichkeit, um dieses Risiko zu senken. Das Ziel: eine Behandlungsmethode zu entwickeln, welche die körpereigene EPO-Bildung wieder normalisiert und den Aufwand sowie das Risiko für den Patienten vermindert. Dafür arbeitet das Pharmaunternehmen mit Professor Iain Macdougall zusammen. Der international renommierte Nierenforscher erlebt am Londoner King’s College tagtäglich, wie sehr seine Patienten unter der Blutarmut leiden: „Sie fühlen sich müde und kraftlos, haben Probleme beim Gehen, leiden an Gedächtnisschwäche und Konzentrationsproblemen“, erklärt er. „All das trägt zu einer sehr geringen Lebensqualität bei, was wiederum Depressionen und Stimmungsschwankungen verstärken kann.“
Derzeit testen die Forscher deshalb die Vorteile einer neuen Therapie mit einer täglichen Tabletteneinnahme, die die körpereigene Produktion von EPO in der Niere anregt. Die Hoffnung: „Dass wir das Problem der risikoreichen Spitzenwerte und des raschen Abfalls des Hb-Wertes damit in den Griff bekommen“, sagt Iain Macdougall. „Die Patienten müssten nur regelmäßig eine Tablette einnehmen, um ihre Blutwerte auf einem guten Level zu halten.“ Das wäre ein großer Vorteil für die Blutarmut-Kranken: Denn die lästigen Injektionen würden für sie entfallen.
Mögliche Anzeichen für eine Blutarmut
Die Anzeichen für eine Blutarmut sind nicht immer eindeutig. Wesentlichen Einfluss darauf haben die Dauer und Schwere der Erkrankung. Deshalb sind die durch den Sauerstoffmangel hervorgerufenen Symptome auch von Patient zu Patient unterschiedlich – sowohl in der Art als auch in der Ausprägung. Hierzu können zählen:
- Konzentrationsprobleme und Müdigkeit
- verringerte körperliche Belastbarkeit
- Kopfschmerzen und Übelkeit
- Schwindel
- Ohrensausen und -pochen
- Sehstörungen
- Atemnot bei Belastung
- Herzklopfen
- Blässe der Haut, Binde- und Schleimhäute
Maya Hügle würde jeder noch so kleine Fortschritt der Forscher das Leben erleichtern. Denn obwohl sie gelernt hat, mit ihrer Krankheit zu leben, richtet sich ihr Alltag seit Jahrzehnten an den regelmäßigen Arztbesuchen aus. „Seit dem Tag der Diagnose fühle ich mich, als hätte mir jemand mein Leben weggenommen.“ Wegen der Behandlung musste sie ihre Zusatzausbildung abbrechen: Immer wieder benötigte sie Bluttransfusionen, bis EPO in den 80er-Jahren gentechnisch hergestellt werden konnte. Auch für ihre Familie wurde die Krankheit zu einer großen Belastung: „Alles drehte sich nur noch um meine Behandlung, und meine Mutter musste mich ständig ins Krankenhaus fahren“, erzählt Maya Hügle. In ihrer Freizeit war sie plötzlich oft allein. Im Dorf wurde getuschelt, Freunde mieden sie. „Sie dachten, ich sei ansteckend.“
Heute haben sich die Behandlungsmethoden deutlich verbessert und die Bevölkerung kennt das Krankheitsbild. Dazu hat auch Maya Hügles Aufklärungsarbeit beigetragen: Als Sektionsleiterin der Interessengemeinschaft Niere NRW Neuss e.V. berät sie ehrenamtlich zweimal pro Woche Betroffene. „Manchmal sind auch junge Frauen darunter, die etwa genauso alt sind, wie ich damals bei meiner Diagnose“, erzählt sie. „Nicht für mich, sondern für diese Frauen hoffe ich, dass die Forschung bald eine Therapie entwickelt, die nicht mehr das ganze Leben bestimmt – denn sie haben ja noch so viel vor sich. Sie sollen nicht alles aufgeben und das gleiche durchmachen müssen wie ich.“